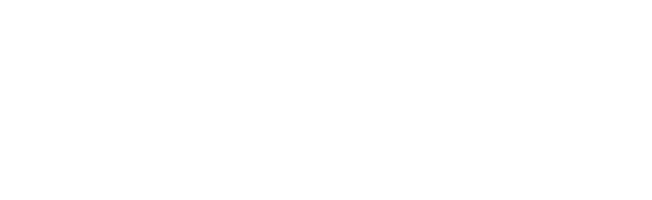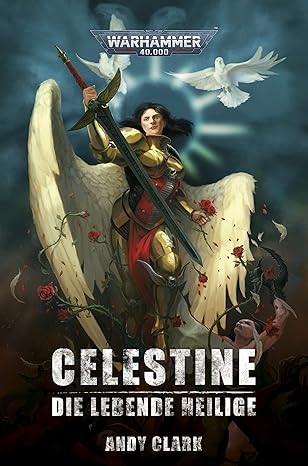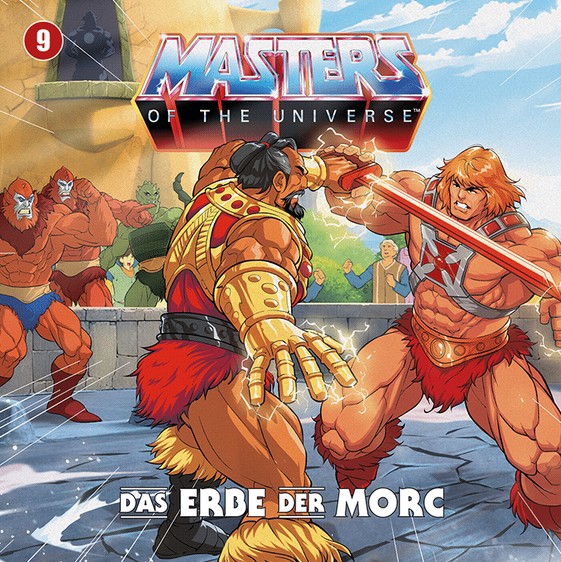Ein Buch über die klingonische Sprache von jemandem, der sich auskennt.
Inhalt (Klappentext)
Seit der ersten Verwendung im ersten Star-Trek-Film von 1979 ist aus der klingonischen Sprache mehr geworden als nur eine Zeile aus einem Film. Genau wie Star Trek ist die daraus entstandene Sprache »Klingonisch« zu einem Teil der Kultur der Menschheit geworden, der nicht mehr wegzudenken ist. Klingonisch ist allgegenwärtig, nicht nur in Star Trek, sondern auch in anderen Serien, Filmen, in der Werbung, Literatur und vielen anderen Bereichen.
In diesem umfassenden Werk erkundet der Klingonischexperte Lieven L. Litaer die Entwicklung der klingonischen Sprache und bringt bisher unbekannte Details hervor, die nicht nur für Trekkies interessant sein können. Dabei macht der Leser eine Zeitreise durch vierzig Jahre Entstehung und Verwendung des Klingonischen.
Eine derart vollständige Beschreibung der Entstehung dieser Kunstsprache ist bisher nie erschienen.
Kritik
Mutig mutig, das muss man schon sagen. Mir als bekennendem Nicht-Klingonen-Fan ein Buch über Klingonisch als Rezensionsexemplar zu schicken, meine ich. Meiner Ansicht nach war spätestens mit dem Ende von TNG das Thema Klingonen derart ausgelutscht, dass mir selbst DS9 da keine neuen Impulse mehr abgewinnen konnte. Von den Nachfolgeserien ganz zu schweigen. Ich war halt schon immer eher Team Romulus bzw. Vulkan.
Klar gab es da noch die Sprache, die in den letzten Jahren weitere Ausläufer wie Übersetzung von Kinderbüchern bekommen hat. Das war für mich immer ein netter Gag (und ich glaube, ich habe sogar den Klingonischen Hamlet rezensiert), aber eigentlich auch nicht viel mehr. Okay, vor 20 Jahren hab ich mal einen klingonischen Sprachkurs bei uns im Rollenspiel gemacht, aber sonst…
Und nun also dieses Buch auf meinem Tisch, geschrieben von niemand geringerem als Lieven Litaer, dem Klingonischlehrer, der sich sicher wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum um die Sprache verdient gemacht hat – in den letzten immerhin 30 (!) Jahren. Persönlich ist mir sein Auftritt bei Stefan Raab in Erinnerung geblieben, bei dem er die Sprache als seriös dargestellt und sich nicht ins Lächerliche hat ziehen lassen. Getroffen habe ich ihn, trotz Fedcon-Vorträgen, bislang aber noch nicht persönlich.
Aber jetzt genug von dem Vorgeplänkel, ihr wollt ja was zum Buch hören. Wer jetzt denkt, eine Art Klingonisch-Buch zu bekommen, der ist hier schon gleich mal falsch. Ja, es gibt hier zwar auch Sätze auf Klingonisch, aber das Hauptaugenmerk liegt auf der Geschichte und Entwicklung der Sprache, und eben nicht klingonischen Sätzen und Vokabeln, dafür gibt es andere Bücher. Was nicht heißen soll, dass es hier gar kein Klingonisch gibt, aber dazu kommen wir gleich noch. Womit dieser Band einen gleich für sich gewinnt, ist die etwas lockere Schreibweise. Hier wird nicht so bierernst alles auf die Waage gelegt, sondern wirklich sachlich, ohne dabei allzu trocken zu wirken. Das gefällt.
Litaer beginnt dabei mit der Erfindung der Sprache und geht dabei natürlich auf James Doohan und den ersten Star Trek-Film ein – Fans wissen, wovon wir reden, denn es gibt hier ja die Okrand-Kontroverse. Achja, ihr müsst keine Angst haben, etwas zu versäumen, wenn ihr kein eingefleischter Trekkie seid, das Buch ist auch einsteigerfreundlich. Nach dem Einlass über die Erfindung wird sogar das Urheberrecht der Sprache angesprochen, eigentlich alles Themen, über die man sich nicht so viele Gedanken macht, die aber hier wohl auch gerade deswegen verdient ihren Platz gefunden haben.
Ergänzt wird auch dieses Buch wieder durch kleine Bildchen, welche Auffälligkeiten auf dem Bildschirm und andere Sachen darstellen, auf die auch im Text eingegangen wird. Wie bereits oben erwähnt, werden immer mal wieder klingonische Sätze und Wörter eingeworfen und wie man sie bildet. Das lenkt stellenweise schon etwas ab, vor allem, wenn es Passagen sind, in denen es eben ganz viele klingonische Begriffe gibt. Das Ganze wird meist garniert mit lustigen Anekdoten so dass es nicht ganz so trocken wirkt, ein bisschen störend kann das aber mitunter anmuten.
Diese Eigenart zieht sich durch das ganze Buch, wird aber später, bei den einzelnen Serien und Filmen, dadurch abgemildert, dass es im Kontext zu eben jenen steht und da passt es dann besser in den Fließtext hinein. Zudem ist es hier dann, sozusagen, in die Geschichte des Klingonischen, um die es ja hier gehen soll, eingewoben. Insgesamt kann man sagen, dass der Autor immer noch „die Kurve kriegt“, bevor die zuvielen klingonischen Ausdrücke in der Häufung langweilig, oder sagen wir eher, überfordernd, wirken.
Auf ca. Seite 78 geht es dann endlich los und wir sind bei Star Trek 3 und erfahren, wie Marc Okrand ins Spiel kam. Hier werden auch eingefleischte Fans sicher noch das ein oder andere neue erfahren.
Bei den einzelnen Serienfolgen wird dann gnadenlos aufgedeckt, welche Wörter falsch sind oder wo Okrand neue Wörter hinzufügen musste. Das ist durchaus unterhaltsam. Etwas schade ist, dass zumindest nicht mal kurz erwähnt wird, dass der deutsche Zuschauer bei “Star Trek III” nicht in den Genuss des allerersten Klingonisch kommt, da ja alles synchronisiert wurde. Immerhin gibt es hier aber auch noch Exkurse wie zum klingonischen Sprachinstitut. Eingebettet ist diese Analyse des Klingonisch (bzw. die Entwicklung) von persönlichen Rückblicken Lievens auf seine Jugendzeit und wie er in die Rolle des Klingonischlehrers hineinschlüpfte. Eine weitere schön passende Auflockerung, bei der man merkt, welche Herzensangelegenheit diese ganze Sache für den Autor ist.
Wenn es in die 2000 bzw. 2010er-Jahre geht, wird es allerdings ein wenig unübersichtlicher, was nicht nur daran liegt, dass Klingonisch zu dieser Zeit einen Boom erlebt hat, sondern es auch Stilblüten wie Opern oder die bereits erwähnten Buchübersetzungen auf Klingonisch gegeben hat. Gefühlt könnte man hier allerdings meinen, dass etwas der Faden verloren geht, nur um dann bei den Reboot-Filmen und den neuen Serien wieder in Spur zu kommen – die werden dann wie zuvor auch schon mit Analysen des Klingonischen abgehandelt. Auch ist der persönliche Werdegang des Autors wieder mit eingeflochten, aber aufgrund des Status des Autors zum Klingonischen bleibt das nicht aus. Immerhin wird es mit dem nötigen Augenzwinkern präsentiert.
Gut ist auch, dass auf Apps wie Duolingo eingegangen wird, und wie gut man damit klingonisch lernen kann. Hier wäre ein Ausblick auf die künftige KI-Entwicklung vielleicht auch noch interessant gewesen, aber das ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Hinzu kommen ein paar Easter Eggs bei den neuen Serien (Stichwort: klingonische Untertitel bei Netflix). Wenn man allerdings denkt, dass diese etwas zu kurz kommen, liegt das daran, dass es in den neuen Serien eben auch wenig klingonisch “zu entdecken” gibt. Allerdings wirkt manches auch etwas redundant. So wird das qepHom z.B. mehrfach erklärt, da hätte man durchaus besser drauf achten können.